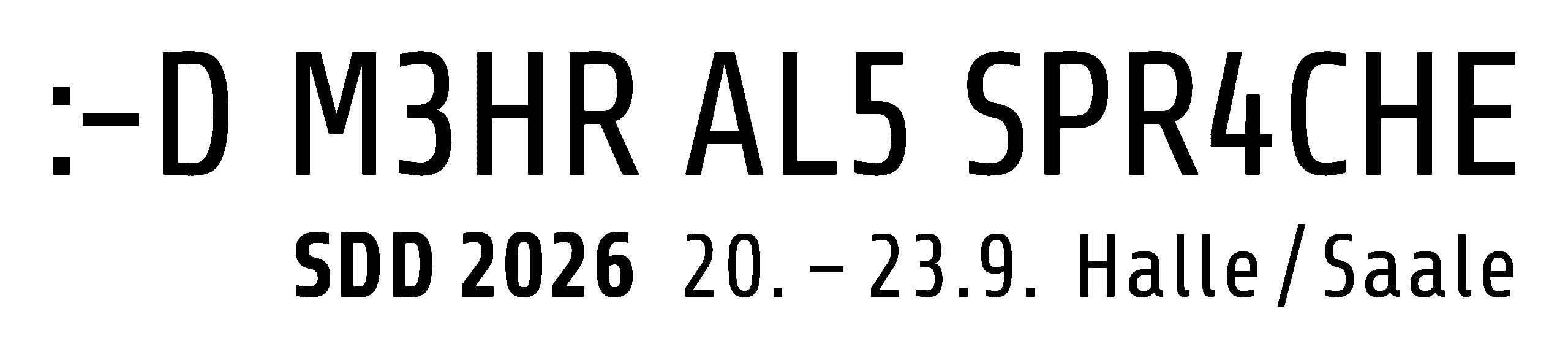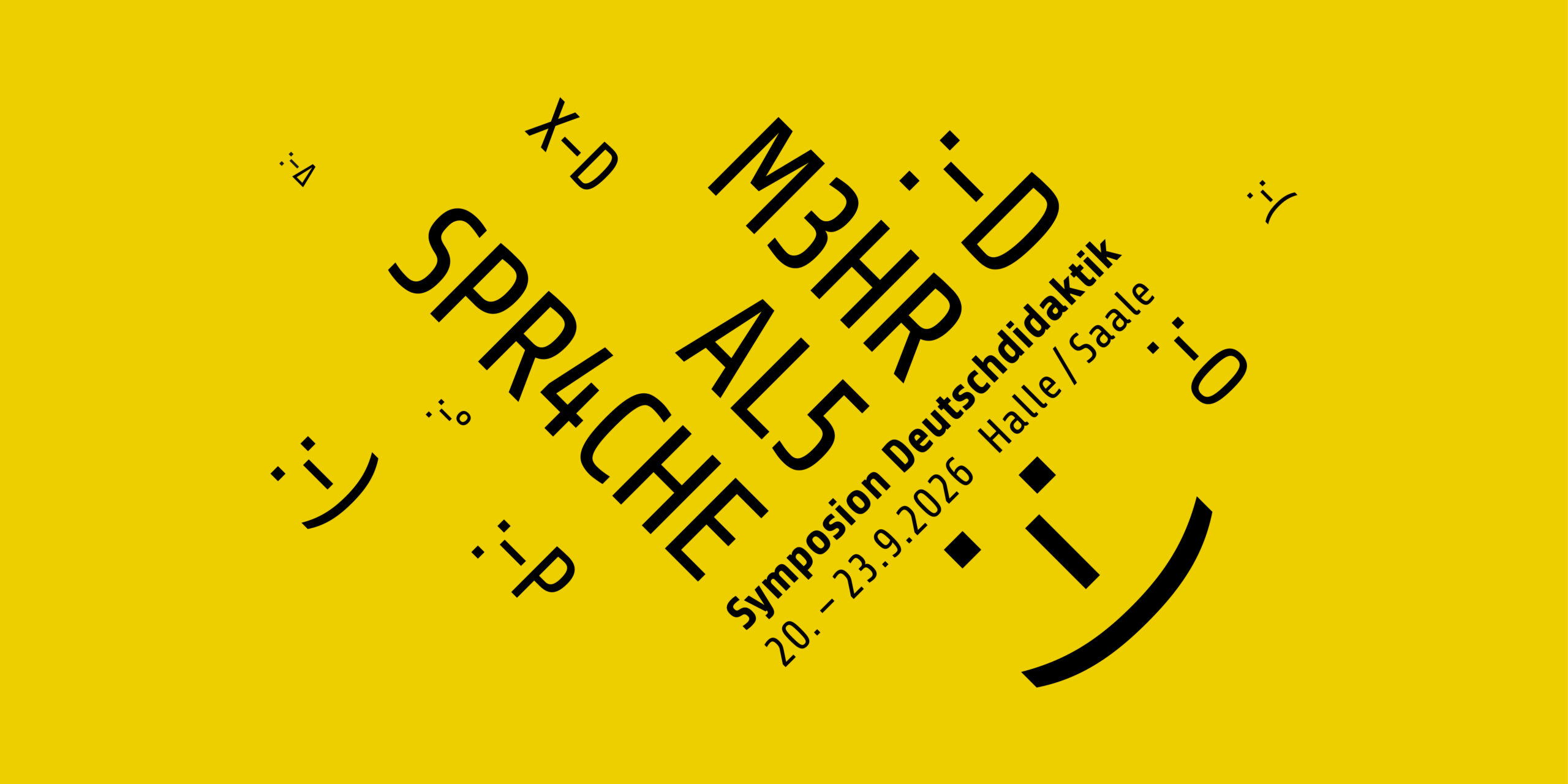
Das Symposion Deutschdidaktik 2026 findet vom 20. bis 23. September an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale) statt. Das Tagungsthema MEHRalsSPRACHE richtet den Blick auf Sprache(n) als Gegenstand und Medium des Deutschunterrichts und eröffnet ein Feld des Austausches über die vielfältigen Bewegungen und Veränderungen in der Deutschdidaktik.
Hier erhalten Sie einen Überblick über die aktuell relevantesten Seiten:

AKTUELLES
Datum: 01.12.2025
Der Call für die Sektionsbeiträge und Panels ist abgeschlossen. Der Call für Poster läuft weiterhin (bis 31.03.).
Datum: 01.08.2025
Der Call für die Sektionsbeiträge, Panels und Poster hat begonnen!
Datum: 03.04.2025
Der Call für die Sektionen hat begonnen!